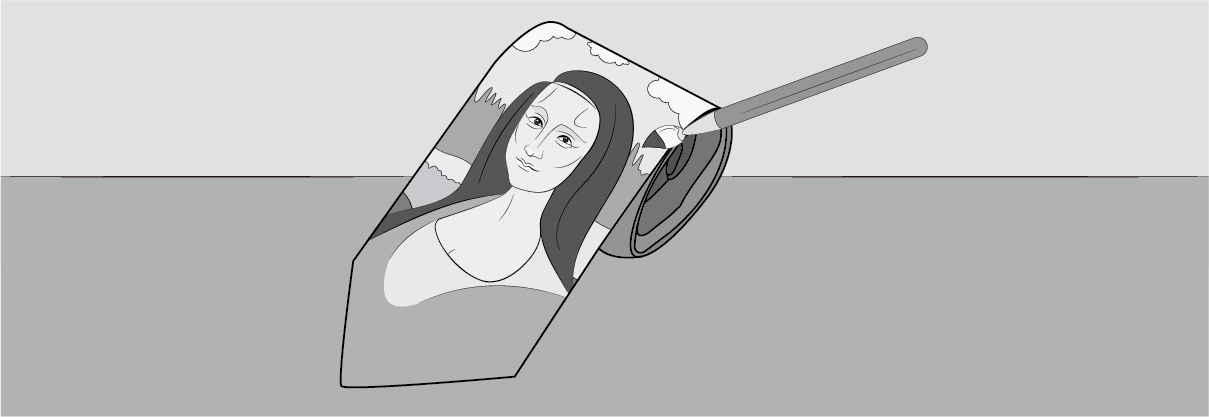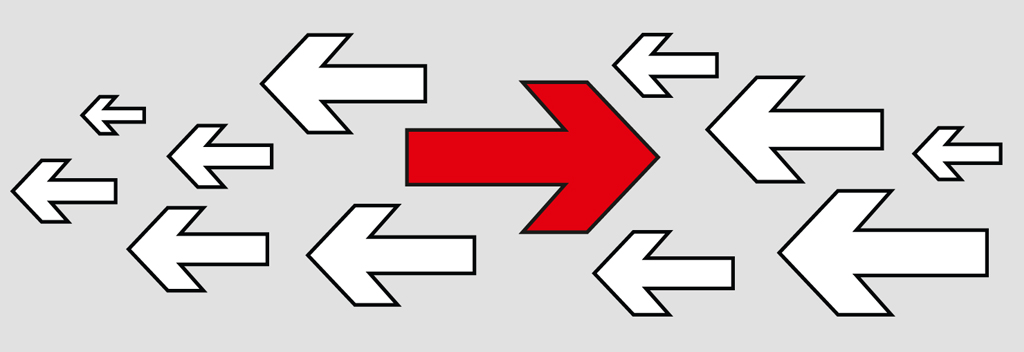
Was Werber von der Bibel lernen können
Vor ein paar Jahren brüskierte ich meine Freunde in einer fröhlichen Runde mit der Aussage, dass ich zumindest theoretisch in der Lage sei, eine völlig neue Bibel zu schreiben. Nachdem sie sich vom ersten Schreck erholt hatten, interpretierten sie meine Äusserung als Grössenwahn und Blasphemie. Natürlich habe ich weder Lust noch Zeit, so ein Buch zu schreiben, doch zum Kern meiner Aussage stehe ich noch heute.
Genau wie die Thora oder der Koran hat die Bibel in unserer Kultur auch ausserhalb der religiösen oder historischen Betrachtungsweise eine wichtige Aufgabe. Lange bevor Juristen Gesetze formulierten, definierten diese Dokumente die ethischen und moralischen Grundsätze der Kulturen, ohne die ein Zusammenleben in Gemeinschaften wohl kaum möglich wäre. So simpel uns die zehn Gebote erscheinen mögen, bis heute orientieren sich alle unsere geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze an diesen Grundsätzen. Die heutigen Gesetzbücher sind lediglich Präzisierungen von dem, was wir aufgrund der biblischen Vorgaben für rechtens erachten.
Das Bemerkenswerte an der Bibel ist, dass die Lebensregeln in Form von Geschichten vermittelt werden, um sie in einen nachvollziehbaren Zusammenhang einzubetten. Dadurch werden diese Regeln besser verstanden, erinnert und lassen sich weitererzählen. Alle Weltreligionen vermitteln ihre ethischen und moralischen Grundwerte in Form von Erzählungen. Hätte man die Bibel in der heute gebräuchlichen Juristensprache verfasst, gäbe es sicher kein Christentum. Ob die biblischen Geschichten auf historischen Wahrheiten basieren oder frei erfunden sind, ist übrigens völlig irrelevant. Die heute verwendeten Texte sind sowieso Übersetzungen von Übersetzungen von Übersetzungen, in die sicher jeder Übersetzer noch seine eigenen Vorstellungen interpretiert hat. Wichtig erscheint mir lediglich die in den Texten enthaltene Botschaft. Ein grosses Problem der heute praktizierten Bibelinterpretation ist, dass die beschriebenen Gegebenheiten nicht mehr in unsere Zeit passen und deshalb möglicherweise falsch oder gar nicht verstanden werden.
Das ist also die Erkenntnis, die mich damals zu der schockierenden Aussage veranlasste, die Bibel mit Beispielen aus unserer Zeit neu schreiben zu können – und dadurch die Verständlichkeit zu verbessern und Missinterpretationen zu reduzieren. Das Grundgerippe der Bibel bliebe natürlich erhalten, aber die Akteure und Schauplätze wären «aktualisiert». Z. B. würde ein Vertreter unserer Zeit die Rolle des barmherzigen Samariters einnehmen. Oder Sodom und Gomorrha wären durch entsprechende heutige Städte zu ersetzen. Auch für die Pharisäer liesse sich sicher eine vergleichbare Gruppierung finden.
Als Werber bin ich mir bewusst, dass die meisten meiner Werke – kaum sind sie fertig gestellt – zu Altpapier recycelt werden. Keine meiner Schöpfungen, und sei sie noch so genial, wird 2000 Jahre überdauern. Aber ich lerne aus dem Buch der Bücher, dass man alle Botschaften – auch schwierige und wenig erbauliche – einem grossen Zielpublikum vermitteln kann, wenn man sie in eine Geschichte verpackt. Darum ist es in der Unternehmenskommunikation sinnvoll, komplexe Inhalte als Case Histories oder unterhaltsame Stories zu kommunizieren.
Denn nur Geschichten, die sich weitererzählen lassen, haben das Potenzial, sich eigenständig zu verbreiten, zum Selbstläufer zu werden, der von Mund zu Mund oder innerhalb der Social-Media-Netzwerke als virale Kommunikation von alleine weitergetragen zu werden.
Fredy Obrecht