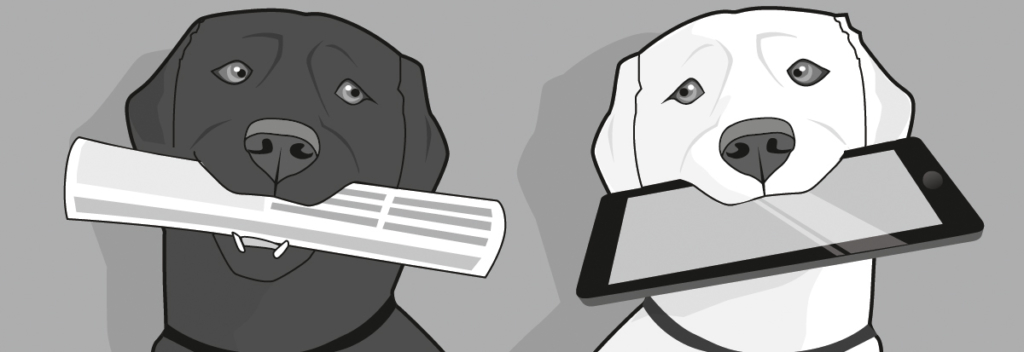Einsichten aus dem Dschungelcamp
Acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich die RTL-Reality-Show «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» angesehen. Moralische oder voyeuristische Aspekte haben andere bereits ausführlich diskutiert. Mich interessieren die Erkenntnisse, die sich daraus für die Unternehmenskommunikation gewinnen lassen. In meinen Augen ist das Camp ein Labor, das überdeutlich zeigt, was passiert, wenn das Feedback der Öffentlichkeit fehlt respektive das Eigenbild mit dem Image in der Öffentlichkeit nicht übereinstimmt.
Seit 2004 werden jedes Jahr zehn mehr oder weniger bekannte Promis für 14 Tage in ein Freiluftcamp im nordöstlichen Australien geschickt. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind völlig von der Aussenwelt abgeschnitten und werden rund um die Uhr von Kameras beobachtet und von Mikrofonen belauscht. Mit dem Satz «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Camp jederzeit vorzeitig verlassen. Täglich haben ein oder zwei von ihnen eine Dschungelprüfung zu absolvieren, bei der sie in Kakerlaken baden, tierische Genitalien essen oder ähnlich eklige Prozeduren über sich ergehen lassen müssen. Als Belohnung für mehr oder weniger erfolgreich bestandene Prüfungen gibt es entsprechend üppige oder magere Essensrationen für die Camp-Mitglieder. Ab der zweiten Woche bestimmen die Zuschauer per Telefonvoting, wer das Camp verlassen muss, bis am Schluss nur noch die Dschungelkönigin oder der Dschungelkönig übrigbleibt.
Kampf ums gute Image
Um zu gewinnen, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Sympathie des Publikums erwerben – ohne zu wissen, wie ihr Verhalten beim Zielpublikum ankommt. Gibt es da nicht eine Parallele zu den Unternehmen? Wer weiss eigentlich, wie das «Corporate Behaviour» in der Öffentlichkeit interpretiert wird? Sind die Massnahmen, mit denen für Vertrauen und Sympathie geworben wird, zielführend? Im Dschungelcamp kann es durchaus sein, dass eine Kandidatin in der Gruppe unbeliebt ist und entsprechend behandelt wird, das Publikum sie hingegen als Opfer wahrnimmt. Tränen können Mitgefühl hervorrufen oder als billiges Theater entlarvt werden. Genauso kann Stärke Bewunderung auslösen oder als unsympathisches Macho-Gehabe abgestempelt werden. Je länger das Camp dauert, umso mehr driften die Wahrnehmung des Publikums und die entstehenden sozialen Strukturen zwischen den Teilnehmenden auseinander. Dabei verstärken die eifrig genutzten Social-Media-Plattformen die Etablierung der Publikumsmeinung.
Meinungsbildung
Zwischen dem abgeschotteten Dschungelcamp und der Führungsetage eines Unternehmens oder dem Vorstand eines Verbandes oder einer politischen Partei gibt es durchaus Parallelen. Auch hier kann sich eine Sicht der Dinge durchsetzen, die stark von der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit abweicht. Je höher die Führungselite aufsteigt, umso grösser ist die Gefahr, dass das Management in seinem Elfenbeinturm vom Feedback der Basis abgeschnitten ist. Basis abgeschnitten ist. Unter Gleichgesinnten klopft man sich gerne gegenseitig auf die Schulter und verstärkt so eine untereinander akzeptierte, aber trügerische Meinung, denn über Erfolg oder Misserfolg wird in der Regel an der Basis, sprich im Markt und nicht im Sitzungszimmer entschieden. Leader-Gehabe kann sowohl als Ausdruck von Selbstvertrauen als auch von Überheblichkeit verstanden werden. Wie im Dschungelcamp können Attacken auf den Mitbewerber Mitgefühl mit dem Schwächeren hervorrufen, während Aufklärung und Argumentation gerne als Besserwisserei oder Bevormundung (miss-)verstanden werden.
Den Puls fühlen
Als externe Berater für Unternehmenskommunikation sind wir in der Verantwortung, die Verbindung zwischen dem Unternehmen und seiner Kundenbasis herzustellen oder nicht abreissen zu lassen. Manchmal ist das keine leichte Aufgabe, denn welcher Auftraggeber schätzt es, wenn ihm ein Spiegel vorgehalten wird, der etwas anderes zeigt, als er erwartet. Allerdings hat mich die Erfahrung gelehrt, dass wir Externen so etwas wie kreative Hofnarren sind, die sich die eine oder andere unangenehme Bemerkung erlauben dürfen – wie folgende Frage an einen meiner Kunden: «Bevorzugen Sie Ehrlichkeit oder Höflichkeit? Kostet beides gleich viel.»
Nicht selten ist es sehr aufwendig und kompliziert, ein Feedback von der Basis abzuholen und richtig zu interpretieren. Doch es ist ganz wesentlich, die Verbindung zu den Menschen aufzubauen und zu pflegen, die über den unternehmerischen Erfolg entscheiden. Branche und Situation sind ausschlaggebend, ob ein einfaches Gespräch ausreicht oder eine umfangreiche Markt- und Meinungsforschung notwendig ist. Dagegen empfiehlt sich in jedem Fall eine Überwachung und Bewirtschaftung der Social-Media-Plattformen. Denn im Gegensatz zu Dschungelcampern können sich Führungskräfte nicht einfach mit dem Satz «Ich bin ein Chef – holt mich hier raus!» aus der Verantwortung stehlen.
Fredy Obrecht